Die Erholungsbeihilfe – Steuerfreiheit und Pauschalversteuerung 2026
.png?width=80&height=80&name=Hubspot_Header_DATEV%20(1).png)
- 20.01.2026
- 6 Min. Lesezeit
Verfasst von: E.Blog Team
Definition Erholungsbeihilfe 2026
Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei der Erholungsbeihilfe um eine finanzielle Unterstützung seitens des Arbeitgebers für Arbeitnehmer. Diese Leistung wird während einer Rekonvaleszenz oder anderen Genesungsphasen gewährt, um Beschäftigte wieder fit für die Arbeit zu machen. Unternehmen können diese Lohnzuwendung einmal jährlich bereitstellen.
Das Besondere: Die Erholungsbeihilfe kommt nicht nur den Mitarbeitern selbst zugute, sondern kann auch für ihre Familienangehörigen gewährt werden.
Die maximalen Beträge für das Jahr 2026 gliedern sich wie folgt, (gegenüber 2025 hat es also keine Veränderung gegeben):
- 156 Euro für den Arbeitnehmer
- 104 Euro für den Ehepartner
- 52 Euro für jedes Kind
Voraussetzungen für die Erholungsbeihilfe
Damit die Erholungsbeihilfe steuerfrei ausgezahlt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Einhaltung der Freigrenzen: Wird die Grenze überschritten, verfällt die Pauschalierung, und die Beihilfe wird voll lohnnebenkostenpflichtig.
- Nur einmal jährlich: Die Erholungsbeihilfe darf nur einmal pro Jahr gewährt werden.
- Nachweis der Nutzung: Sie muss für Erholungszwecke ausgegeben und durch Quittungen belegt werden, die den ausgezahlten Betrag nicht unterschreiten.
- Keine Übertragbarkeit: Freibeträge sind nicht übertragbar.
- Zeitlicher Zusammenhang: Die Zahlung muss innerhalb von 3 Monaten vor oder nach dem Urlaubsantritt erfolgen. Die Länge des Urlaubs ist dabei unerheblich.

Erklärung der Grafik: Voraussetzungen für die Erholungsbeihilfe: Sie kann nur einem Haushalt und einmal pro Jahr gewährt werden. Die Erholungszeit muss mindestens eine Woche betragen. Der Zeitraum zwischen Zahlung und Erholung darf höchstens 3 Monate betragen. Steuerfrei ist die Erholungsbeihilfe nach eine Krankheit bis zu 600 € und 500 € bei der Förderung der Gesundheit. Als pauschale Besteuerungsgrenze gelten für den Arbeitnehmer 156 €, für den Ehepartner 104 € und für das Kind 52 €
Welche Maßnahmen werden durch die Erholungsbeihilfe unterstützt?
Urlaubsreisen
Erholungsurlaube im In- und Ausland. Dazu zählen insbesondere Unterkunft und Reisekosten.
Kuren oder Wellnessurlaube mit Fokus auf Entspannung und Regeneration.
Wellness- und Gesundheitsprogramme
- Kosten für Massagen, Sauna- und Spa-Besuche.
- Anwendungen, die der Regenration, Stressreduktion oder körperlichen Wiederherstellung dienen.
Freizeitaktivitäten
- Eintrittskosten für Schwimmbäder, Thermen oder Sportstätten.
- Gebühren für Aktivitäten wie Wandern, Yoga-Kurse oder andere entspannende Freizeitbeschäftigungen.
Sport und Bewegung
- Maßnahmen zur körperlichen Fitness, wie etwa Reha- oder Entspannungssport.
- Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Sportvereinen, die der körperlichen Erholung dienen.
Kuren und rehabilitative Maßnahmen
- Gesundheits- und Rehamaßnahmen in spezialisierten Einrichtungen.
- Leistungen, die vom Arzt empfohlen werden, wie etwa Heilbäder oder klimatische Behandlungen.
Familienerholung
- Erholungsaufenthalte für Familien in Familienhotels oder Ferienanlagen.
- Unternehmungen für Familien, um psychische und emotionale Belastungen zu mindern (z. B. Vater-Kind-Kuren).
Drei-Monats-Frist beachten
Die Einmalzahlung der Erholungsbeihilfe, ob als Barzuschuss oder Sachlohn, muss innerhalb von drei Monaten vor oder nach der Erholungsmaßnahme erfolgen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Betrag für Erholungszwecke genutzt wird, z. B. durch Belege für Urlaube, Thermen- oder Freizeitparkbesuche. Die Auszahlung kann entweder mit dem Gehalt oder in Form von Sachbezügen, etwa über Anbieter wie Edenred, erfolgen.
Wer kann durch die Erholungsbeihilfe profitieren?
Wie erwähnt: Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer eine Erholungsbeihilfe bekommen:
- Vollzeitangestellte
- Beschäftigte in Teilzeit
- studentische Mitarbeiter
- geringfügig Beschäftigte (Minijobber)
Da der Prozess der Genesung und Gesundung auch Familienangehörige tangiert, kann der Arbeitgeber auch unmittelbaren Familienangehörigen finanzielle Unterstützung für die Erholung gewähren.
Ist der Mitarbeiter verheiratet, so können sowohl der Ehepartner als auch eigene Kinder durch die Erholungsbeihilfe profitieren. Bei Kindern gelten dabei folgende Regelungen.
Hinweis zu den Voraussetzungen der Erholungsbeihilfe: Kinder und Altersgrenzen
Als Kind wird man bis zum 18. Lebensjahr sowie bis zum 21. und 25. Lebensjahr unter besonderen Bedingungen gezählt.
Bis zum 21. Lebensjahr zählt man als Kind im Sinne sozial- und steuerrechtlicher Regelungen, wenn kein Beschäftigungsverhältnis besteht und eine Meldung als arbeitssuchend bei einer Agentur für Arbeit vorliegt.
Dies gilt insbesondere für Kindergeldansprüche. Voraussetzung ist, dass die Person aktiv eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle sucht, der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht und die Meldung regelmäßig aktualisiert. Eine Unterbrechung der Arbeitssuche kann den Anspruch beeinflussen.
Darüber hinaus kann es weitere Sonderfälle geben, die mit einem spezialisierten Anwalt oder Steuerberater abgeklärt werden sollten.
Die Versteuerung ist dabei bis zu einer Höchstgrenze gesondert geregelt, so dass die Erholungsbeihilfe für den Arbeitnehmer steuerfrei und für den Arbeitgeber pauschal abzuführen ist. Dazu wird sie zusätzlich zum ohnehin gezahlten Arbeitslohn gewährt. Dem Arbeitnehmer kommt somit die gesamte Zuwendung steuerfrei zu Gute.
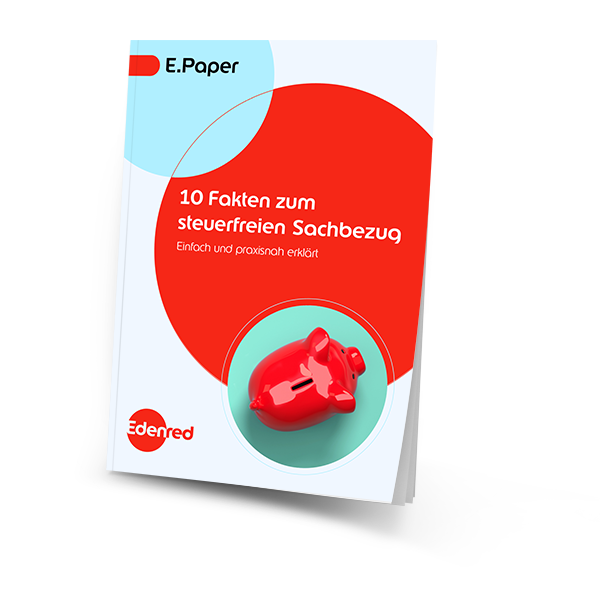
Erholungsbeihilfe steuerfrei? Diese Regelungen gelten
Geregelt sind Erholungsbeihilfen im § 40 Abs. 2 Nr. 3 EStG. Grundsätzlich zählt diese Arbeitgeberleistung zum steuerpflichtigen Gehalt, unabhängig davon, in welcher Form – ob bar oder als Sachzuwendung – die Beihilfe dem begünstigten Arbeitnehmer zugutekommt.
Allerdings besteht die Möglichkeit, Erholungsbeihilfen pauschal mit 25 % zu versteuern, sofern die gesetzlich festgelegten Freigrenzen eingehalten werden.
Erholungsbeihilfe und Pauschalversteuerung
Durch die Pauschalversteuerung kann der Arbeitgeber die Erholungsbeihilfe faktisch steuerfrei für den Arbeitnehmer gestalten. Obwohl Steuern anfallen, übernimmt der Arbeitgeber die pauschale Steuerlast von 25 %, sodass der Arbeitnehmer nicht belastet wird. Zusätzlich fallen auf diese Beihilfe keine Sozialversicherungsbeiträge an.
Ein Unternehmen möchte seinem Mitarbeiter und dessen Familie eine Erholungsbeihilfe zahlen. Die gesetzlich festgelegten Höchstbeträge für die Erholungsbeihilfe sind wie gesagt:
- 156 Euro für den Mitarbeiter,
- 104 Euro für den Ehepartner und
- 52 Euro pro Kind.
| Mitarbeiter: | 156 Euro |
| Ehepartner: | 104 Euro |
| Kind 1: | 52 Euro |
| Kind 2: | 52 Euro |
| Gesamt: | 364 Euro |
Auf diese 364 Euro muss der Arbeitgeber eine Pauschalsteuer von 25 % zahlen. Zusätzlich fallen auf die Pauschalsteuer noch der Solidaritätszuschlag (5,5 %) und ggf. die Kirchensteuer (je nach Bundesland 8 % oder 9 %) an:
| Steuer | Steueranteil | Betrag |
| Pauschalsteuer | 25 % von 364 Euro: | 91 Euro |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 % von 91 Euro: | 5,01 Euro |
| Kirchensteuer (z. B. 9 % in Bayern) | 9 % von 91 Euro: | 8,19 Euro |
| Gesamt: | 104,20 Euro |
Während der Arbeitnehmer für sich und seine Familie insgesamt 364 Euro Erholungsbeihilfe steuerfrei erhält, belaufen sich die Gesamtkosten für den Arbeitgeber durch die Pauschalversteuerung auf:
364 Euro (Erholungsbeihilfe) + 104,20 Euro (Steuern) = 468,20 Euro.
Steuerfreie Sachbezüge ermöglichen es Arbeitgebern gemäß § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG, Arbeitnehmern bis zu 50 Euro pro Monat brutto wie netto zukommen zu lassen (z. B. in Form einer Sachbezugskarte). Kombiniert man diesen Mitarbeitervorteil mit der Erholungsbeihilfe, reduziert sich der pauschal zu versteuernde Betrag aus dem obigen Beispiel um 50 Euro; gleichzeitig verringert sich dadurch die steuerliche Belastung für den Arbeitgeber.
| Mitarbeiter: | 156 Euro |
| Ehepartner: | 104 Euro |
| Kind 1: | 52 Euro |
| Kind 2: | 52 Euro |
| steuerfreier Sachbezug | -50 Euro |
| Gesamt: | 314 Euro |
Entsprechend vermindert sich für den Arbeitgeber auch die Steuerlast nach der Pauschalversteuerung:
| Steuer | Steueranteil | Betrag |
| Pauschalsteuer | 25 % von 314 Euro | 78,50 Euro |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 % von 78,50 Euro | 4,32 Euro |
| Kirchensteuer | 9 % von 78,50 Euro | 7,07 Euro |
| 89,89 Euro |
Die Gesamtkosten für den Arbeitgeber betragen somit:
364 Euro (Erholungsbeihilfe) + 89,89 Euro (Steuer) = 453,89 Euro.
468,20 Euro - 453,89 Euro = 14,31 Euro.

Interesse an steuerfreien Sachbezügen?
Nutzen Sie die Vorteile der Erholungsbeihilfe durch steuerfreie Sachbezüge. Informieren Sie sich jetzt über die Möglichkeiten und profitieren Sie von attraktiven Angeboten für Ihre Erholung!
Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung steuerfrei
Die Erholungsbeihilfe kann steuerfrei sein, wenn sie der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder der Gesundheitsförderung dient, z. B. bei Kuren und Reha-Aufenthalten. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge sind bis zu 600 Euro pro Jahr für Maßnahmen bei Berufskrankheiten und bis zu 500 Euro pro Jahr für die allgemeine Gesundheitsförderung steuerfrei. Die Regelungen bieten Spielraum, um steuerpflichtiges Urlaubsgeld, pauschal versteuerte Erholungsbeihilfen und Gesundheitsförderung effektiv zur Verbesserung der Mitarbeitergesundheit zu nutzen.
Noch Fragen? Lassen Sie sich von uns kostenfrei und unverbindlich beraten, wie Sie für Ihre Mitarbeiter diesen Bonus mit den Lösungen von Edenred anbieten können.
-
Die Erholungsbeihilfe ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, kein gesetzlicher Anspruch. Sie gilt für Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber diese gewährt, z. B. per Arbeitsvertrag, Betriebs- oder Tarifvereinbarung.
Zudem muss die Beihilfe zweckgebunden für Erholung genutzt und durch Quittungen nachgewiesen werden. -
Die Höhe der steuerlich begünstigten Erholungsbeihilfe wird durch die gesetzlich festgelegten Freigrenzen im Einkommensteuergesetz (§ 40 Abs. 2 Nr. 3 EStG) geregelt. Stand derzeit gelten folgende jährliche Höchstbeträge, die auch 2026 gelten werden (Änderungen vorbehalten, da Anpassungen vom Gesetzgeber abhängig sind):
- 156 Euro für den Arbeitnehmer,
- 104 Euro für den Ehepartner,
- 52 Euro für jedes Kind.
Die Erholungsbeihilfe darf nur diese Beträge pro Jahr und Person umfassen, um steuerrechtlich begünstigt (pauschal mit 25 % versteuert) zu sein. Überschreiten die Zahlungen diese Grenzen, entfällt die Pauschalversteuerung, und die gesamte Beihilfe gilt als steuerpflichtiges Einkommen.
Für aktuelle Informationen zu möglichen Änderungen ab 2026 sollten Sie die Gesetzgebung im Auge behalten oder Rücksprache mit einem Steuerberater halten.
-
Der Hauptunterschied zwischen Urlaubsgeld und Erholungsbeihilfe liegt in der Zweckbindung und steuerlichen Behandlung:
- Urlaubsgeld: Steuer- und sozialabgabenpflichtige Zusatzleistung ohne Verwendungszweck.
- Erholungsbeihilfe: Zweckgebundene Zahlung für Erholung (z. B. Urlaub, Wellness) mit Nachweispflicht. Kann pauschal mit 25 % versteuert werden, sofern Freigrenzen eingehalten werden.
Welche Nachweise sind für die Erholungsbeihilfe wichtig?
Der Zweck der Erholungsbeihilfe muss nachgewiesen werden, sonst wird sie steuerpflichtig.
- Belege vorlegen: Quittungen für Urlaubsaufenthalte, Wellness, Reha oder ähnliche Maßnahmen sind erforderlich.
- Zweckbindung sicherstellen: Die Mittel müssen eindeutig für Erholung genutzt werden; der Arbeitgeber dokumentiert dies bei Bedarf.
-
Die Erholungsbeihilfe ist für den Arbeitnehmer steuerfrei, wenn der Arbeitgeber die Steuerlast übernimmt und die Zahlung pauschal mit 25 % versteuert, zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen Höchstbeträge eingehalten werden: 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 Euro für den Ehepartner und 52 Euro für jedes Kind. Ein über diese Grenzen hinausgehender Betrag wäre steuer- und sozialabgabenpflichtig.
Zudem muss die Erholungsbeihilfe zweckgebunden für erholungsfördernde Maßnahmen wie Urlaube, Wellness oder Kurztrips verwendet werden. Wird dies durch Quittungen oder Belege nachgewiesen, bleibt die Zahlung für den Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei. Ohne Zweckbindung oder Pauschalversteuerung durch den Arbeitgeber gelten die Beträge als steuerpflichtiger Arbeitslohn.
-
Die Erholungsbeihilfe kann von Arbeitgebern freiwillig gezahlt werden, um Mitarbeiter und deren Familien bei erholungsfördernden Maßnahmen wie Urlaub, Wellnessaufenthalten oder Freizeitaktivitäten zu unterstützen. Sie ist auf folgende Höchstbeträge beschränkt: 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 Euro für den Ehepartner und 52 Euro für jedes Kind. Wichtig ist, dass die Leistung zweckgebunden verwendet wird, z. B. durch Quittungen oder Rechnungen nachgewiesen werden kann. Die Zahlung darf nur einmal im Jahr erfolgen und ist unabhängig von Urlaubs- oder Krankheitszeiten möglich.
Um steuerliche Vorteile zu nutzen, kann der Arbeitgeber die Erholungsbeihilfe pauschal mit 25 % versteuern, plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Sozialversicherungsbeiträge fallen dabei nicht an. Überschreiten die gezahlten Beträge die festgelegten Höchstsummen, wird die Differenz steuer- und sozialabgabenpflichtig. Die Erholungsbeihilfe muss klar von regulären Gehaltszahlungen abgegrenzt werden und darf nicht als dauerhafter Bestandteil des Lohns gezahlt werden.
-
Die Erholungsbeihilfe wird häufig auch als steuerfreie Erholungspauschale, Erholungsgeld oder Urlaubshilfe bezeichnet. Wichtig ist jedoch die korrekte Verwendung des Begriffs, um Missverständnisse zu vermeiden – gerade im Hinblick auf steuerrechtliche Aspekte, da für die Erholungsbeihilfe besondere gesetzliche Regelungen gelten.
Sie wird als zusätzlicher Mitarbeiterbenefit gewährt und kann beispielsweise für ein Wellnesswochenende oder Kurzurlaube genutzt werden. Wenn von 'Urlaubshilfe' gesprochen wird, meint man oft die zusätzliche Gewährung der Erholungsbeihilfe im Zusammenhang mit steuerpflichtigem Urlaubsgeld.
Die genannten Regelungen ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung. Es gelten stets die Voraussetzungen nach EStG und LStR.








